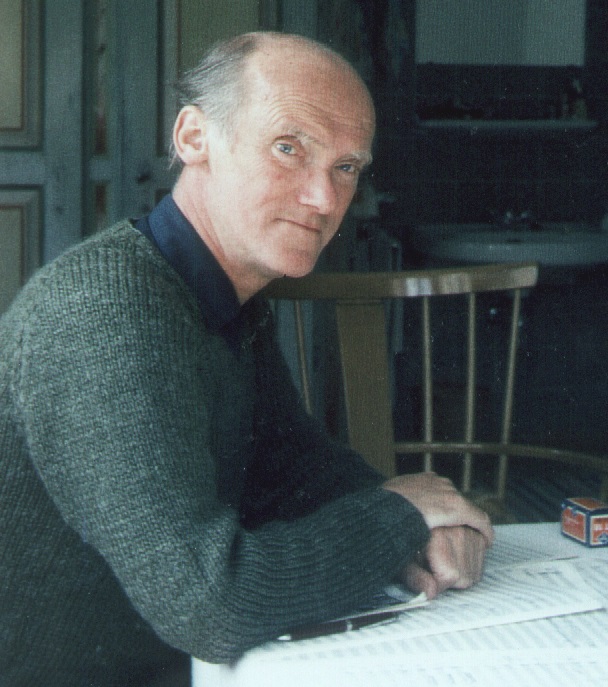
Helmut Degen 1911 - 1995
...ureigenes
reflektives Musikantentum... feines spielmännisches Flair, aber immer obsiegt
das Geistige...
(Ulrich Dalm)
-:-:-:-:- Lebensdaten -:-:-:-:-
|
1911 |
geb. in
Aglasterhausen bei Heidelberg als Sohn des Pfarrers Erwin Degen, ab dem
5. Lebensjahr zeichnerische und musikalische Begabung gefördert, |
|
ab 1920 |
kommen
Harmonielehre, Kontrapunkt und Cello dazu. Er begleitet die
Hausandachten auf dem Harmonium. Sonntags Streichquartettspiel mit Vater
und den beiden Brüdern, später auch Trio-, Duo- und 4händ.
Klavierliteratur. |
|
1923-25 |
(Mit 12-14 J.)
Komposition des ersten größeren Werkes: „Waldvögleins Hochzeit” für vier
Gesangssolisten und Klaviertrio, aufgeführt 1925 und 1926 im Hause Degen
in Anwesenheit von GMD Hans Gelbke aus M.Gladbach. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1925 (am Cello) mit Vater und Brüdern |
|
|
|
|
1925-30 |
(Ab 14 J.)
angestellter Organist in Odenkirchen, bald bekannt für seine
Improvisationen. |
|
|
|
Kirche von Odenkirchen 1918 |
|
|
|
|
|
|
1926ff. |
Kompositorische
Auseinandersetzung mit der traditionellen Musik von Bach bis Liszt,
Reger und Strauss. |
|
1928ff. |
Auseinandersetzung mit Schönberg: Suche nach neuen Wegen in der Moderne. Öffentliche
Aufführung eines Klaviertrios in Odenkirchen Malen und
Zeichnen zugunsten des Klavierspiels aufgegeben. |
|
1930 |
Beginn des
Studiums in Köln bei
Wilhelm
Maler,
Philipp
Jarnach und Ernst-Gernot Klußmann, Staatsexamen in
Theorie und Komposition 1932 mit Auszeichnung. |
|
|
|
|
1932 |
erste
Veröffentlichung von Kompositionen. |
|
1933 |
Auflösung des
Kammerorchesters aus finanziellen Gründen nach dem Tod des Vaters. Beginn des
Studiums der Musikwissenschaft (bei Schiedermair und Schrade) in Bonn. |
|
1934 |
2 Sendungen in
Radio Luxemburg: Concertino f. Klavier u. Orch.; Konzert f. Orch. Radio München:
Kammermusik für Violine und Klavier
- ebenso 1935 in Radio Köln |
|
1936 |
Aufnahme in den
Verlag B.Schott’s Söhne. Dresden
Philharmonie: Uraufführung „Festliches Vorspiel” unter Paul van Kempen. Musikfest in
Darmstadt: Uraufführung „Symphonische Musik” unter Karl Friderich. |
|
|
|
|
|
|
|
1936 in
Altenkirchen |
|
|
|
|
|
1937 |
Internationales
Musikfest Baden-Baden: Uraufführung der „Geusenlied-Variationen”. |
|
|
|
|
Duisburger Konservatorium |
|
|
|
|
|
1938 |
Internationales
Musikfest Baden-Baden: Großer Erfolg mit „Symphonischen Konzert” Dirigat der
Berliner Philharmoniker mit Geusenlied-Variationen. |
|
1939 |
Musikpreis aus
Stiftung der „Gesellschaft der Musikfreunde e.V. Baden-Baden” und
damit
verbunden Erteilung eines Werkauftrages (Capriccio für Orchester
1939). |
|
1940 |
Klavierkonzert
bei
Berliner Philharmonikern
unter
Carl Schuricht
(Solist:Udo Dammert). |
|
|
|
 |
Ölgemälde von Kurt Weinhold ca. 1940 |
|
|
|
|
1941 |
|
|
|
Uraufführung des
Ballett „Der flandrische Narr”
nach de Coster (Freiheitskampf der Niederländer [Geusen] gegen spanische
Herrschaft) in Braunschweig - es folgen Aufführungen in Essen (unter eigener Leitung), Brüssel, Antwerpen,
Gent, Chemnitz u. a. |
|
|
|
|
1942 |
5 Aufführungen
des „Capriccio für Orchester” durch
Hermann
Abendroth haben
viele weitere Aufführungen zur Folge. |
|
|
|
|
|
Aufgabe von
Wohnung und Anstellung in Duisburg wegen der Bombenangriffe. Lehrstelle
an der Hermann-Lietz-Schule in Buchenau/Hersfeld. |
|
|
|
|
1943 |
Osteroratorium |
|
1944 |
Arbeitsdienstverpflichtung in Maschinenfabrik. |
|
1946 |
Internationale
Ferienkurse für Neue Musik
Darmstadt: |
|
1947 |
Donaueschingen:
1.Streichquartett. |
|
1948 |
Concertino für 2
Klaviere und Orchester - in Hannover unter
Franz
Konwitschny. |
|
1948 |
Uraufführung der Kammersinfonie (2. Sinfonie) im Südwestfunk
Musikpädagogische Tagung in Bayreuth: 4. Klaviersonate
im Hessischen Rundfunk (Erika Frieser). |
|
1949 |
Uraufführung des
„Konzertes für Streichorchester” in Wuppertal. |
|
|
|
|
1949/50 |
Besprechungen
mit
Erich
Kästner in München, wegen der
Textfassung von |
|
|
|
|
|
|
|
Musikfest der
IGNM in Frankfurt: |
|
|
Ferenz
Fricsay dirigiert das „Konzert
für Streichorchester”. |
|
|
Uraufführung des
2.Streichquartetts im Süddeutschen Rundfunk (Barchet-Quartett). |
|
|
Arbeitswoche für Neue Komposition in Barsbüttel bei Hamburg, |
|
|
Vortrag: „Beiträge zur
Erneuerung der Kompositionstechnik”. |
|
1954 |
Ernennung zum
Professor Filmmusik zum
preisgekrönten Dokumentarfilm
„Willy Baumeister“ |
|
|
|
|
1958 |
Handbuch der
Formenlehre
- Grundsätzliches zur musikalischen Formung
(Bosse-Verlag, Regensburg) Uraufführung des
„Sinfonischen Spiel I” im Hessischen Rundfunk unter Otto Matzerath. Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt |
|
|
- Vortrag „Gedanken zur
Formenlehre”. |
| Kompositorische Aspekte in dieser Zeit |
|
- Neue
Auseinandersetzung mit der 12-Ton-Technik und seriellen Formen,
jedoch kein Verzicht auf eigene Tonsprache und konzertantes
Musizieren - Die Entwicklung
der seriellen Musik der Avantgarde in den 50er- und 60er-Jahren mit
seinem rationalen Konstruktivismus konnte und wollte er trotz
gelegentlicher freier Verwendung nicht mitvollziehen. Bei offener
und toleranter Haltung gegenüber allem Neuen jedoch keinerlei
Huldigung von
Modeerscheinungen. - in der Folge
davon: weniger Interesse bei Veranstaltern moderner Musik und bei
Verlegern. Lehrtätigkeit
im Vordergrund, aber stete Weiterführung und Entwicklung des
Komponierens: „Tradition und
Gegenwart, äußerste Kühnheit der Mittel und Einfachheit in Gedanken,
aussagekräftig als Kunstwerk und den Menschen erfassend: so will ich
mein Werk, gleich welcher Richtung es sich anschließt”(1970) „Tradition und
Neuzeit fasse ich auf meine Art zusammen. Nicht schulisch, sondern
vielgestaltig, aber als Helmut Degen.”(1971) |
|
|
|
|
1960 |
Begegnung mit
Paul Hindemith, |
|
|
-
dessen Originalzeichnung: |
|
|
|
|
|
„für Helmut Degen zur Erinnerung, Paul Hindemith
30.11.60” |
|
|
|
|
|
ca 1960 HD mit
Ernst Krenek |
|
|
|
|
1961 |
Uraufführung des
„Sinfonischen Spiels II” im Süddeutschen Rundfunk unter H.Müller-Kray. |
|
|
|
|
1962 |
Johannes-Passion
Schallplattenaufnahme des Osteroratoriums unter Gerd Witte. |
|
|
|
|
1964-1970 |
Arbeit an der
„Genesis” |
|
1965 |
Schallplattenaufnahme der Johannes-Passion mit Vocaalensemble Hilversum unter der Leitung von
Marinus
Voorberg. |
|
|
|
|
|
|
1970 (Foto W.
Schmidt) |
|
|
|
|
wichtige
Spätwerke: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 |
|
|
|
|
1992 |
|
|
|
|
|
Helmut Degen
stirbt am 2.Oktober 1995 |
|
Gerd Witte
schreibt: |
|
„Ein langes Leben endete, das von einer großen geistigen Intensität erfüllt gewesen war. ‘Nicht ich komponiere, es komponiert in mir’ pflegte Helmut Degen zu sagen und deutete damit auf den Zwang hin, unter dem er seine kompositorischen Ideen entwickelte und verwirklichte. Wenn Arnold Schönbergs Meinung zutrifft, ‘daß ein Komponist ein Mensch ist, der in der Musik lebt und alles, ernst oder nicht ernst, gründlich oder oberflächlich, mit musikalischen Mitteln ausdrückt, weil es seine angeborene Sprache ist’, dann war Helmut Degen ein Komponist.” |
|
|











